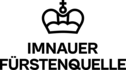Spielbetrieb im Kinderhandball
Der Deutsche Handballbund (DHB) hat im November 2014 Durchführungsbestimmungen für eine einheitliche Wettkampfstruktur im Kinderhandball beschlossen. Für den Bereich des Baden-Württembergischen Handball-Verbandes (BWHV) wurden diese Bestimmungen durch Experten aus allen drei Landesverbänden beraten, präzisiert und im Sinne der Kinderhandballkonzeption des DHB ergänzt.
Folgenden Kernprinzipien wurden bei der Erstellung der Durchführungsbestimmungen zugrunde gelegt. Ausführlichere Informationen hierzu finden sich in der Kinderhandballkonzeption des DHB:
- Entwicklungsgerechte Spielformen: Kinder sollen im Wettkampf Spiele spielen, die sie fordern, aber nicht überfordern. Große Spielfelder und viele Spieler auf dem Feld können Kinder nur eingeschränkt wahrnehmen.
- Systematischer Aufbau: Kinder entwickeln sich wesentlich schneller als Jugendliche. Die Anforderungen durch den Wettkampf müssen sich daher ebenfalls schrittweise und systematisch erhöhen. Dabei soll jede Form auf dem zuvor Erlebten aufbauen.
- Handballnahe Spielformen: Kinder kommen in unsere Vereine, um Handball zu spielen. Daher soll die zentrale Spielform in jedem Alter das Handballspiel in seiner Idee abbilden, um den Kindern das Gefühl eines „richtigen“ Handballspiels zu geben.
- Flexibilität für Anfänger und Fortgeschrittene: Im Kinderhandball kommen noch verhältnismäßig viele Quereinsteiger mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Vereine. Zudem ist die Leistungsfähigkeit der Spieler meist sehr unterschiedlich. Schwächere oder neue Spieler sollen durch vereinfachte Spielformen an das Spiel herangeführt werden können.
- Einfache Umsetzung: Durchführungsbestimmungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie auch in der Praxis umgesetzt werden können. Eine hohe Verständlichkeit und Klarheit der Formulierungen ist ebenso wichtig wie sich wiederholende Grundprinzipien in den Wettkampfformen.
- Klare und einfache Regeln: Die in diesen Durchführungsbestimmungen vorgegebenen Regeln sind elementar dafür, dass die Ausbildungsziele der Spielformen wirklich erreicht werden können. Diese müssen von Schiedsrichtern und Kinderhandballspielleitern umgesetzt werden, die nur unregelmäßig Spiele pfeifen. Regeln müssen daher klar formuliert und einfach verständlich sein.
- Abwechslung über die Altersklassen hinweg: Kinder, die bereits bei den Minis mit dem Handballspielen beginnen, durchlaufen acht oder mehr Jahre im Kinderhandball und müssen regelmäßig neue Impulse im Wettkampf erhalten. Dadurch wird langfristig die Freude am Handball aufrechterhalten.
Mit den geltenden „Ergänzenden Durchführungsbestimmungen im Kinderhandball“ fallen die motorisch-koordinativen Übungen als Wettkampfbestandteil in der F-Jugend weg. In der Vergangenheit wurden hier meist die (einfacheren) Übungen des E-Jugend-Übungskatalogs verwendet, so dass die Kinder mitunter 5-6 Jahre (bei Früheinsteigern) dieselben Übungen machen mussten. Die Motivation ließ damit in der E-Jugend (wenn das wichtigste Lernalter erreicht ist) meist deutlich nach. Mit speziellen Übungen für die F-Jugend, welche mit der Förderung von Bewegungserfahrungen die Besonderheiten des Alters bewusst ansprechen, wollen wir die Qualität hier weiter verbessern.
Im F-Jugendalter soll in Zukunft das Sammeln von Bewegungserfahrung in spielerischer Form ohne Wettkampfcharakter im Vordergrund stehen. Alle Mannschaften sollen die Bewegungslandschaft durchlaufen – auch wenn sie erst „am Ende“ nach den beiden Spielformen an der Reihe sind. Daher sollen in dem Hallendrittel auf dem nicht gespielt wird, ca. 2-4 möglichst attraktive Stationen aufgebaut werden, die von 2 Begleitpersonen beaufsichtigt und den Kindern erklärt werden. Die Übungen sollen motorischen und koordinativen Charakter haben und durch Vielseitigkeit motivierend und freudbetont sein. Dabei sollen die Möglichkeiten in der jeweiligen Sporthalle genutzt werden. Mit dem vorliegenden Dokument wollen wir den ausrichtenden Vereinen grundlegende Hinweise über die Durchführungsbestimmungen hinaus geben, wie diese Bewegungsparcours aussehen können.
Die Stationen der Bewegungslandschaft können in folgende Gruppen unterteilt werden (wir schlagen maximal eine Station pro Gruppe vor):
- Bewegungsparcours: Bewältigen eines Parcours aus einer oder mehreren Stationen „auf Zeit“ (evtl. als Staffel mit einer Gesamtzeit pro Mannschaft), um einen Wettkampfcharakter zu schaffen. Dabei sollen verschiedene Bewegungsformen und koordinative Aufgabenstellungen zum Einsatz kommen (Laufen, Springen, Kriechen, Krabbeln, Hangeln, Stützen, Rollen, …). Durch "freies" Probieren sollte den Kindern keine Vorgabe bei der Bewältigung gemacht werden.
- Balltransport: Transportieren eines Balles durch einen Parcours „auf Zeit“ (evtl. als Staffel mit einer Gesamtzeit pro Mannschaft), um einen Wettkampfcharakter zu schaffen. Dabei kann der Ball z.B. getragen, geprellt, gerollt oder geworfen aber zum Beispiel auch mit dem Fuß oder einem Hockeyschläger geführt werden. Die zu laufende Strecke kann mit Hindernissen (Slalom, Reifen, Matte usw.) in ihrer Schwierigkeit variiert werden.
- Ziele treffen: Werfen mit Zielvorgabe (Hütchen, Korb, Kasten, …). Dabei können neben dem Werfen eines Handballs unterschiedliche Bälle (große, kleine, leichte, schwere) zum Einsatz kommen oder Schläger etc. genutzt werden. Beim Werfen können auch die Wurfposition und die Distanz zum Ziel variiert werden.
Die Motivation spielt hierbei für die Kinder eine entscheidende Rolle. Es sollen daher nicht aus einem festen Katalog Übungen abgerufen, sondern möglichst viel Abwechslung angeboten werden. Viele Vereine haben in der Vergangenheit bereits tolle Bewegungslandschaften bei Minispielfesten aufgebaut, aus denen viele Elemente verwendet werden können. Auch die Übungen, die beim Grundschulaktionstag verwendet werden, sind gute Beispiele. Um einen besseren Eindruck zu vermitteln, was mit den oben genannten Gruppen gemeint ist, wollen wir im Folgenden dennoch einige Beispiele aufführen:
Bewegungsparcours:
- Im Internet finden sich viele Ideen, z.B. hier.
- In Google Bildern nach „Bewegungslandschaft Beispiele“ suchen
Balltransport:
- Transportstaffel: Verschiedene Bälle müssen durch einen Slalomkurs auf verschiedene Arten transportiert werden. Die Mannschaft darf selbst entscheiden, welcher Spieler z.B. prellt, mit dem Fuß führt, rollt, mit dem Hockeyschläger spielt etc. Beim zweiten Durchgang muss gewechselt werden.
- Ball im Spinnengang auf dem Bauch transportieren (als Staffel).
- Ball über verschiedene Hindernisse prellen (auf Bank laufen und daneben prellen und umgekehrt, auf Matte prellen, …).
Zielwurf:
- In ein Tor werden verschiedene Ziele (Markierungshemdchen, Hütchen, Reifen, …) gehängt und gestellt. Wie viele Würfe braucht eine Mannschaft bis alle Ziele abgeworfen wurden?
- Ein Medizinball muss von einer Mannschaft durch Würfe ins Tor befördert werden.
- Bälle in einen schräg gegen die Wand gestellten kleinen Kasten werfen (darf nicht wieder raus springen); Ball gegen die Lederfläche eines schräg gegen die Wand gestellten Kastens werfen und wieder fangen; Ball als Aufsetzer in einen offenen dreiteiligen großen Kasten werfen. Drei Würfe auf jede Station. Wie viele Treffer schafft jeder?
- Durch einen Reifen passen: Eine Mannschaft teilt sich in zwei Gruppen und spielt sich gegenüber den Ball immer als Bodenpass durch einen am Boden liegenden Reifen zu. Dabei liegt vor jeder Gruppe eine Turnmatte und beim Passen muss das Stemmbein auf der Matte stehen. Nach dem Pass an der eigenen Gruppe anstellen. Wie viele korrekte Pässe schafft die Mannschaft in 2 Minuten?
- Zielwurf auf einen Basketballkorb. Aus einem Meter Entfernung zählt ein Treffer einfach, aus zwei Metern doppelt, aus drei Metern dreifach. Jeder Spieler hat drei Würfe. Wie viele Punkte schafft die Mannschaft?